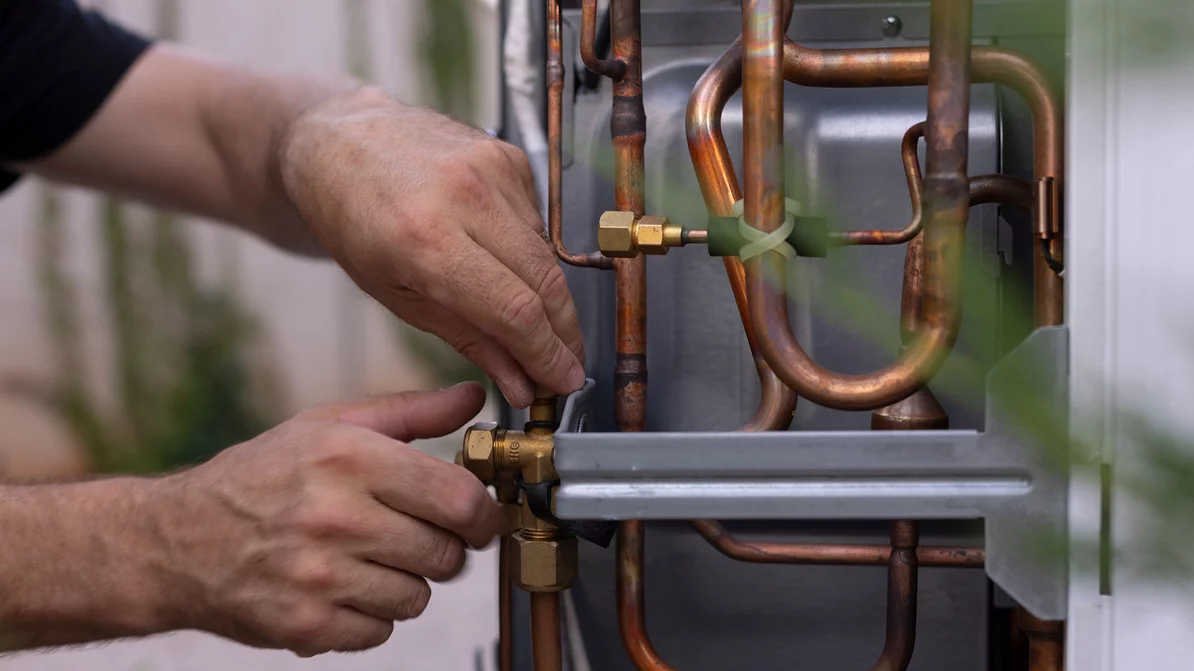Wärmepumpe richtig dimensionieren
So bestimmen Sie die optimale Leistung Ihrer Wärmepumpe
Bei der Auswahl einer Wärmepumpe kommt es vor allem auf die richtige Größe an. Damit sind weniger die Abmessungen der Wärmepumpe gemeint, sondern es wird konkret bestimmt, wie viel Heizleistung die Wärmepumpe in Kilowatt (kW) liefern kann – und ob diese Leistung zur Heizlast eines Gebäudes passt. Denn sowohl eine zu groß wie auch eine zu klein dimensionierte Wärmepumpe arbeitet ineffizient und damit unwirtschaftlich. Zur Bestimmung der optimalen Größe einer Wärmepumpe ist daher zunächst eine Bestandsaufnahme nötig.

Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
Da für die optimale Auswahl einer Wärmepumpe die Heizlast eines Gebäudes die Grundlage darstellt, muss diese so genau wie möglich bestimmt werden. Dies regelt die Norm DIN EN 12831. Beim Antrag auf staatliche Fördermittel für eine Wärmepumpe – etwa von der KfW oder aus kommunalen Programmen – muss eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vorgelegt werden. Diese Norm bildet die verbindliche Grundlage für die Förderprüfung.
Die exakte DIN-Formel zur Bestimmung der Heizlast eines Gebäudes sieht wie folgt aus:
Heizlast (in Watt) = Transmissionswärmeverlust (in Watt) + Lüftungswärmeverlust (in Watt) + Zusätzliche Aufheizleistung (in Watt)
Der Transmissionswärmeverlust bestimmt die Menge der Wärme, die durch die Gebäudehülle, wie Wände, Fenster, Dach und Boden von innen nach außen verloren geht – also durch sämtliche Teile des Gebäudes, die an die Außenluft oder unbeheizte Räume wie Garagen grenzen. Dieser Wärmeverlust tritt dauerhaft auf, sobald innen geheizt wird und außen eine niedrigere Temperatur herrscht.
Der Lüftungswärmeverlust beschreibt den Wert, zu dem die Wärme durch den Luftaustausch mit der Außenluft verloren geht. Verursacht werden diese Lüftungswärmeverluste durch den Austausch von warmer Innenluft und kälterer Außenluft. Dies kann durch gezieltes Lüften geschehen, aber auch durch Fenster in Dauerkippstellung oder undichte Stellen in Fugen oder Ritzen von Fenstern, Türen oder Mauerwerk eines Gebäudes.
Die dritte Größe, die bei der Heizlastberechnung berücksichtigt wird, ist die Aufheizleistung. Diese definiert die zusätzliche Heizleistung, die notwendig ist, um ein Gebäude oder einen Raum nach einer Abkühlphase wieder auf die gewünschte Solltemperatur zu bringen – zum Beispiel morgens nach einer Nachtabsenkung oder nach einem längeren Leerstand.
Bei der Heizlastberechnung werden also verschiedenste Faktoren berücksichtigt. Auch die Dämmung, die Eigenschaften der Gebäudehülle – der so genannte U-Wert - sowie der Standort bzw. die Klimazone eines Gebäudes sind weitere Parameter zur genauen Berechnung. Darüber hinaus wird die genaue Wärmeverteilung, also ob beispielsweise mit Heizkörpern oder einer Fußbodenheizung geheizt wird und wie sich die Luft zwischen den einzelnen Räumen austauscht. Ganz maßgeblich ist letztlich die erforderliche Energiemenge, um die gewünschten Raumtemperaturen zu erzielen und konstant zu halten. Das Ergebnis dieser Heizlastberechnung schließlich bestimmt die Größe, also die notwendige Leistung einer Wärmepumpe.
Eine Überschlagsrechnung gibt eine erste Orientierung
Bevor eine Fachfirma mit der exakten Berechnung der Heizlast beauftragt wird, ist es für Immobilienbesitzer immer hilfreich, vorab schon einmal ein erstes Gefühl über die benötigte Leistung einer zukünftigen Wärmepumpe zu bekommen.
Dazu lässt sich die benötigte Heizlast auch grob durch eine Überschlagsrechnung bestimmen. Die Überschlagsrechnung ist eine vereinfachte Methode, um schnell eine grobe Einschätzung zur benötigten Heizleistung einer Immobilie zu erhalten. Sie ersetzt keine exakte Berechnung nach DIN EN 12831, bietet jedoch eine solide Orientierung.
Die überschlägige Berechnung wird über eine einfache Formel erstellt und ersetzt nicht die detaillierte Heizlastberechnung eines Fachbetriebs, gibt jedoch bereits einen groben Richtwert für die Heizlast an.
Zur Überschlagsrechnung der Heizleistung wird die nachstehende Formel angewandt:
Wohnfläche (in m²) × spezifischer Heizlastwert pro m² (in W/m²) = Heizlast gesamt (in Watt)
Der spezifische Heizlastwert berücksichtigt in aller Regel die Gebäudeart, das Baujahr der Immobilie und deren Status der Dämmung.
Typische Richtwerte für den spezifischen Heizlastwert von Gebäuden sind:
| Gebäudeart / Dämmstandard | Heizlastwert (W/m2) |
|---|---|
| Passivhaus / sehr gut gedämmt | 15 - 30 W/m2 |
| Neubau (nach EnEV / GEG an ca. 2002 | 40 - 60 W/m2 |
| Teilsanierter Altbau | 60 - 100 W/m2 |
| Unsanierter Altbau | 100 - 150 W/m2 |
Eine Beispielrechnung für einen teilsanierten Altbau mit 120 m² Wohnfläche:
Heizlast = 120 m² × 80 W/m² = 9.600 W → ca. 9,6 kW
Diese Leistung muss die Heizungsanlage (z. B. Wärmepumpe) an kalten Tagen mindestens bereitstellen können.
Natürlich berücksichtigt diese Methode keine Raumaufteilung, Heizkörpergrößen, Lüftungsverluste oder Aufheizleistung. Die korrekte und konkrete Heizlast-Bestimmung erfordert Fachwissen sowie spezielle Berechnungsprogramme, daher sollten Sie damit immer einen qualifizierten Fachbetrieb beauftragen.
Auch, wenn aktuell keine Wärmepumpe angeschafft werden soll, ermöglicht Ihnen eine Heizlastberechnung, Ihre bestehende Heizungsanlage optimal zu dimensionieren bzw. eine energetische Sanierung wie etwa die Dämmung des Dachs gezielt zu planen. Denn eine Heizlast-Berechnung liefert detaillierte Informationen über den aktuellen Zustand eines Gebäudes und zeigt auf, wo die größten Energiesparpotenziale liegen.
Eine gute Basis für die schnelle Bestimmung eines Heizlast-Richtwerts bietet hier der Überschlagsrechner des Bundesverbandes Wärmepumpe e.V. : https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/heizlastrechner/
Die durchschnittliche Größe von Wärmepumpen in einem Einfamilienhaus liegt übrigens zwischen 5 und 16 Kilowatt.
Was passiert, wenn die Wärmepumpe zu klein oder zu groß ist?
Eine optimal dimensionierte Wärmepumpe kann ihre volle Leistung entfalten, da sie exakt auf die vorhandenen Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Ändern sich diese Bedingungen, kann die Wärmepumpe nicht mehr effizient und im schlimmsten Fall unwirtschaftlich arbeiten.
Ist eine Wärmepumpe unterdimensioniert, also zu klein, wird das Haus nicht ausreichend warm. Dies lässt sich vor allem an kälteren Tagen mit geringer Außentemperatur spüren.
Ist die Wärmepumpe überdimensioniert bzw. zu groß, arbeitet sie oft ineffizient: Sie erreicht die gewünschte Raumtemperatur sehr schnell und schaltet deshalb immer wieder ab und an. Dieses ständige Ein- und Ausschalten – das sogenannte Takten – belastet vor allem den Kompressor, da beim Start jedes Mal hohe Kräfte wirken. Die Folge sind ein unnötig hoher Stromverbrauch und ein stärkerer Verschleiß der Technik, was die Lebensdauer der Wärmepumpe verkürzt.
Fazit
Vor der Wahl einer Wärmepumpe muss der Wärmebedarf der Immobilie ermittelt werden, die Heizlast. Diese Heizlast bestimmt dann die Leistung der Wärmepumpe. Die exakte Heizlast-Berechnung berücksichtigt verschiedene Faktoren rund um die Immobilie und wird nach DIN EN 12831 von einem professionellen Fachbetrieb durchgeführt. Nur eine exakt ausgelegte Wärmepumpe arbeitet effizient sowie wirtschaftlich und spart langfristig Kosten. Ist die Wärmepumpe über- oder unterdimensioniert, führt dies schnell zu höheren Stromkosten und einem schnelleren Verschleiß der Technik.